Einschätzung des BGH zu Diesel-Klagen: Wichtige Infos für Betroffene
Letzte Aktualisierung am: 12. Februar 2025
Geschätzte Lesezeit: 6 Minuten
Der Bundesgerichtshof macht Diesel-Besitzern Mut: Sachmangel liegt vor

Alle Fahrzeugmodelle, egal ob Diesel oder Benziner, müssen vor der Zulassung beweisen, dass sie nur eine bestimmte Menge an Schadstoffen ausstoßen. So soll eine übermäßige Luftverschmutzung durch den Verkehr vermieden werden.
Verschiedene Autobauer, allen voran VW, haben jedoch bei den betreffenden Tests betrogen. Sie haben Diesel-Fahrzeuge mit dem Motor EA 189 mit einer sogenannten Abschalteinrichtung ausgestattet. Diese konnte erkennen, wann sich ein Fahrzeug auf dem Prüfstand befand – wann es also getestet wurde. Dann schaltete es automatisch in einen Modus, in welchem weniger Abgase ausgestoßen wurden.
Nachdem der Diesel-Skandal ans Licht kam, fühlten sich die meisten Kunden betrogen und verraten. Doch im Gegensatz zu Kunden in den USA bekamen sie in Deutschland keinerlei Schadensersatz. Aus diesem Grund legten viele Betroffene Klage gegen VW & Co ein. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) unterstützt nun Diesel-Besitzer in ihrem Vorgehen.
Inhaltsverzeichnis:
FAQ: Urteil des BGH zu Diesel-Klagen
Diesel-Fahrzeuge des Autoherstellers VW sind mit einer Software ausgestattet, die den tatsächlichen Schadstoffausstoß verschleiert. Das bezieht sich u. A. auf Kfz mit dem Motor EA 189. Ein Grundsatzurteil wurde am 25. Mai 2020 gefällt. Dieses besagt, dass Volkswagen jenen Kunden Schadensersatz zahlen muss, in deren Auto der Konzern die illegale Abschalteinrichtung eingebaut hatte. Denn damit habe VW seine Autokäufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt. Mehr dazu erfahren Sie hier.
Nein. Auch die Tochterfirmen Seat, Audi, Porsche und Skoda haben diesen Motor verbaut.
Bevor der BGH ein Grundsatzurteil fällen konnte, einigten sich VW und viele Kläger außergerichtlich.
Wichtige Urteile und Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Dieselskandal
In dieser Tabelle finden Sie alle wichtigen BGH-Urteile sowie Beschlüsse zum Abgasskandal:
| Datum | Entscheidung des Bundesgerichtshofs | Aktenzeichen |
|---|---|---|
| 30.07.2021 | BGH entscheidet: Bei Teilnahme an der Musterfeststellungsklage stoppt die Verjährung der Schadenersatzansprüche (rückwirkend zum 1.11.2018 - Tag der Klageerhebung) | VI ZR 1118/20 |
| 19.01.2021 | 1. Beschluss zum Daimler-Thermofenster: Autobesitzer können Anspruch auf Schadensersatz haben, wenn Autohersteller das KBA bewusst falsch über illegale Mechanismen informiert haben. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. | VI ZR 433/19 |
| 30.07.2020 | Laut BGH-Urteil gibt es keine Entschädigung, wenn das Kfz nach dem 22. September 2015 gekauft wurde. | VI ZR 5/20 |
| 30.07.2020 | BGH-Urteil: Es gibt keine Entschädigung, wenn das Kfz bereits die zu erwartende Laufleistung erbracht hat - in der Regel 250.000 gefahrene Kilometer (bei größeren Kfz u. U. 300.000 Kilometer). | VI ZR 354/19 |
| 30.07.2020 | BGH-Urteil: Opfer des Abgasskandals erhalten keine zusätzlichen Zinsen auf den Kaufpreis. Erstattet wird nur der Kaufpreis (abzüglich der gefahrenen Kilometer). | VI ZR 397/19 |
| 25.05.2020 | Grundsatz-Urteil des BGH: VW muss den Kaufpreis (unter Anrechnung der gefahrenen Kilometer) dem Kläger erstatten. | VI ZR 252/19 |
| 08.01.2019 | (Hinweis-)Beschluss des BGH: Käufer von Kfz mit illegaler Abschalteinrichtung können Schadensersatzansprüche geltend machen. | VIII ZR 225/17 |
Grundsatzurteil des BGH zur Dieselaffäre vom 25. Mai 2020 (VI ZR 252/19)

Geklagt hatte ein Mann aus Rheinland-Pfalz, der sich 2014 einen gebrauchten VW Sharan für knapp 31.500 Euro kaufte. Im darauffolgenden Jahr erfuhr er, dass VW in seinem Wagen Manipulationssoftware verbaut hatte. Diese reduzierte die Stickoxide zwar im Prüfstand, nicht aber außerhalb des Prüfstands im öffentlichen Straßenverkehr.
Der Kläger fühlte sich getäuscht. Wenn er von der Manipulation gewusst hätte, hätte er das Fahrzeug nicht gekauft. Auch der BGH moniert diesen VW-Abgasskandal und stuft das Verhalten des Autobauers als vorsätzlich sittenwidrige Schädigung ein. In der Begründung des BGH-Urteils heißt es hierzu:
„Die Beklagte hat […] im eigenen […] Gewinninteresse durch bewusste und gewollte Täuschung des KBA systematisch, langjährig […] Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware […] so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte […] nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden. Damit ging einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einher, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhalts eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung hinsichtlich der betroffenen Fahrzeuge erfolgen könnte. Ein solches Verhalten ist […] besonders verwerflich und mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren. […]“
Quelle: Pressemitteilung Nr. 063/2020 vom 25.05.2020 zum ersten Urteil des BGH über den VW-Abgasskandal
Kläger muss sich gefahrene Kilometer als Nutzungsvorteil anrechnen lassen

Der Kläger forderte den vollen Kaufpreis zurück, während VW überhaupt nichts bezahlen wollte. Der Konzern argumentierte, dass das Auto stets benutzbar war und seinem Kunden damit gar kein Schaden entstanden sei.
Im BGH-Urteil zum Diesel-Abgasskandal stellen die Richter klar, dass dem Kläger sehr wohl ein Schaden entstanden ist, und zwar in Form einer „ungewollten vertraglichen Verpflichtung“. Der Kunde hat mit dem Kaufvertrag ein Fahrzeug bekommen, das für seine Zwecke nicht voll brauchbar war.
Deshalb kann der Kläger die Erstattung des Kaufpreises verlangen – gegen Rückgabe des Fahrzeugs und unter Anrechnung der bereits gefahrenen Kilometer.
Die Anrechnung dieses Nutzungsvorteils begründet der BGH im Urteil mit dem schadensersatzrechtlichen Bereicherungsverbot. Danach darf der Kläger durch den Schadensersatz nicht bessergestellt werden, als er ohne den ungewollten Vertragsschluss stünde.
Lange Zeit kein BGH-Urteil zum Diesel-Skandal wegen außergerichtlichen Einigungen
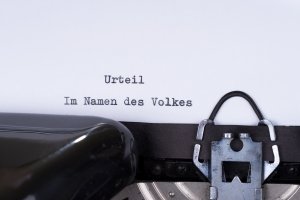
Zunächst zu den Hintergründen, warum sich der BGH mit der Diesel-Thematik beschäftigt: Der Besitzer eines Volkswagen Tiguan 2.0 TDI hatte gegen den deutschen Autobauer geklagt, weil sein Fahrzeug mit einer unerlaubten Abschalteinrichtung ausgestattet war. Er forderte Schadensersatz, weil er sich betrogen fühlte, und befürchtete, auch bald von Diesel-Fahrverboten betroffen zu sein. Des Weiteren kritisierte er, dass Kunden in anderen Ländern entschädigt wurden, während deutsche Verbraucher lediglich mit einem Software-Update zufrieden gestellt werden sollten.
Schlussendlich landete der Fall vor dem Bundesgerichtshof, der letzten Instanz in Fällen dieser Art. Dort sollte der BGH zur Diesel-Klage ein Urteil fällen. Dazu kam es jedoch nicht. Der VW-Besitzer zog seine Klage nämlich im letzten Moment zurück. Der Grund: Er hatte sich zuvor mit VW auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Wie genau er entschädigt wurde, darüber durfte sein Anwalt keine Auskunft geben.
Folgen der Erst-Einschätzung durch den BGH zu Diesel-Klagen
Auch wenn es lange kein offizielles Urteil vonseiten des BGH zur Diesel-Problematik gab, so hat er sich doch auch früher schon zu einigen offenen Fragen geäußert und am 08. Januar 2019 eine für betroffene Kunden wichtige Einschätzung abgegeben (Aktenzeichen VIII ZR 225/17).
Der BGH gab bekannt, dass es sich bei der verbauten Abschalteinrichtung um einen Sachmangel laut § 434 Abs. 1 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) handele. Dieser besagt Folgendes:
Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln, […]wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann.
Die Begründung des BGH dazu, dass Diesel mit Abschaltautomatik einen Sachmangel aufweisen, lautet wie folgt: Es besteht die Gefahr, dass das Kraftfahrt-Bundesamt betroffene Diesel-Fahrzeuge stilllegt, weil bei diesen unzulässige Teile verbaut wurden. Das führt dazu, dass der Pkw nicht mehr im Straßenverkehr genutzt werden darf. Das bedeutet wiederum, dass er sich nicht mehr für den gewöhnlichen Gebrauch eignet.
Gibt es ein BGH-Urteil zum Diesel-Fahrverbot?

In Hamburg und Stuttgart wurden bereits Diesel-Fahrverbote eingerichtet, in vielen weiteren Städten können ähnliche Maßnahmen ergriffen werden. Viele Diesel-Fahrer sind in Anbetracht dessen stark verunsichert. Sie wissen nicht, wie lange sie noch mit ihrem Selbstzünder uneingeschränkt mobil sein dürfen, und fragen sich, ob sie bald dazu gezwungen sind, ein moderneres Fahrzeug kaufen zu müssen.
Vor diesem Hintergrund kommt bei vielen Betroffenen die Frage nach den rechtlichen Hintergründen der gefallenen bzw. bevorstehenden Entscheidungen auf. Hat der BGH Diesel-Fahrverbote legitimiert?
Nein, der BGH hat hierbei bislang keine Rolle gespielt. Von Bedeutung dafür, dass Diesel-Fahrverbote eingeführt werden können, ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Dieses hat im Februar 2018 geurteilt, dass Fahrverbote grundsätzlich zulässig seien.

Danke
Wurde der Kaufvertrag überhaupt erfüllt? Eine Frage der Prioritäten. Was ist die entscheidende Kaufvertragsvereinbarung?
Da der Kauf eines Fahrzeuges ohne Strassenverkehr-Zulassung sinnlos ist, würde die Auslieferung eines Fahrzeuges, daß absichtlich nicht den bei der Zulassung vorgelegten Eigenschaften entspricht, keine vollständige Kaufvertragserfüllung bedeuten. Durch die Verheimlichung der fehlenden Zulassungsfähigkeit wurde dem Käufer zudem absichtlich die Möglichkeit vorenthalten, bis zur Klärung der Zulassungsfähigkeit das Fahrzeug gegebenenfalks nicht zu nutzen. Die tatsächliche Nutzung unter diesen Umständen dennoch dem Käufer zuzurechnen verstößt zumindest gegen EU-Recht,. Ein solche Entscheidung führt zum prozessualen Anachronismus, daß die Entscheidung in der Hauptsache (Vertragsmangel) im Extremfall durch die Nebensache (Nutzwertausgleich) ad absurdum geführt wird. Vermutlich wird so aber auch gegen deutsches Zivilrecht verstoßen, ist darüberhinaus originäre Ursache der Überlastung deutscher Gerichte infolge “lohnender” Verzögerungsstrategien durch Instrumentalisierung der Prozessordnung.
Das Problem liegt hier in der Vielzahl von “paste-copy”- Entscheidungen deutscher Gerichte zur Nutzwertberücksichtigung. Die Fortführung dieser “nonsens”-Gesetzesauslegung schreckte bisher viele Halter von VW-Diesel mit hoher km-Leistung von einer Klage ab. Die bisherige Verjährungsauslegung bietet auch keine “Heilungsmöglichkeit” dieser “nonsens”-Gesetzungsauslegung.
VW trägt also ein erhebliches Risiko, daß sich die bisherigen deutschen Entschädigungs- Szenarien noch erheblich zum Nachteil von VW verändern können. Dieses potentielle Risiko haben die von VW beauftragten Anwälte bisher in den meisten Vergleichsangeboten (noch) nicht berücksichtigt. Sobald der BGH einen entsprechenden Hinweisbeschluss zur arglistig sittenwidrig erwirkten Nutzung einer Sache erläßt, würde die Signalwirkung zur Rücknahme einer Vielzahl von anhängigen Klagen führen.