Was ist Prozesskostenhilfe und wer bekommt sie?
Letzte Aktualisierung am: 16. April 2025
Geschätzte Lesezeit: 9 Minuten
Prozesskostenhilfe: unter welchen Voraussetzungen sie gewährt wird

Wer schon einmal in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt war, beispielsweise nach einem Unfall im Straßenverkehr, der weiß, dass es nicht immer zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen den Parteien kommt. Oftmals weisen die vermeintlichen Anspruchsgegner jegliche Verantwortung von sich oder stellen selbst noch Forderungen gegen die anspruchstellende Partei. Da kommt rasch der Gedanke auf, das Ganze über ein Gericht zu klären.
Doch eben jener Weg ist stets auch mit Kosten, in der Regel in nicht geringem Umfang, verbunden. Nicht selten schreckt dies betroffene Parteien, vor allem solche mit niedrigem Einkommen, davon ab, ein Gerichtsverfahren anzustreben.
Allerdings besteht von Gesetz wegen die Option, in bestimmten Fällen und unter gewissen Voraussetzungen, die sogenannte Prozesskostenhilfe (kurz: PKH) in Anspruch zu nehmen. Umgangssprachlich wird die Prozesskostenhilfe auch als Armenrecht bezeichnet. Doch wann genau kann man eine derartige Gerichtskostenbeihilfe in Anspruch nehmen? Welche Voraussetzungen sind daran geknüpft und gibt es für die Prozesskostenhilfe eine Einkommensgrenze?
In dem folgenden Ratgeber können Sie Informationen rund um das Thema Prozesskostenhilfe einholen.
Inhaltsverzeichnis:
FAQ: Prozesskostenhilfe
Bei der PKH handelt es sich um eine Art staatliches Darlehen, das die Deckung der entstehenden Prozesskosten in einem Rechtsstreit gewährleisten soll. Dieses muss entweder in Raten, ganz, teilweise oder gar nicht zurückerstattet werden (entscheidend sind die Einkommensverhältnisse des Betroffenen).
Ob nun Kläger oder Beklagter – Personen, die aufgrund ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage sind, die Prozesskosten selbst zu tragen, können in der Regel PKH beantragen. Welche Voraussetzungen dabei genau erfüllt sein müssen, erfahren Sie hier.
Die PKH wird zunächst aus der Landeskasse gezahlt. Je nachdem, wie viel Einkommen der Berechtigte erzielt, kann eine Ratenzahlung bestimmt werden. Der Betroffene muss die Prozesskostenhilfe also ggf. zumindest teilweise zurückzahlen. Mehr Infos zur Rückzahlungspflicht erhalten Sie hier.
Begriff und gesetzliche Grundlagen

Der Begriff „Prozesskostenhilfe“ umfasst eine von Seiten des Staates gewährte finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Personen zum Zwecke der Durchführung eines Gerichtsverfahrens.
Grundsätzlich kommt die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe in Anspruch zu nehmen, in Verfahren vor den Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichten in Betracht.
Prozesskostenhilfe können im Strafverfahren hingegen lediglich Nebenkläger oder Adhäsionskläger in Anspruch nehmen.
In Fällen notwendiger Verteidigung in Strafverfahren greift hingegen die sogenannte Pflichtverteidigung.
Gesetzliche Regelungen darüber sind in den §§ 114 ff der hierzulande geltenden Zivilprozessordnung (kurz: ZPO) enthalten.
Welche Personen gelten im Gerichtsverfahren als anspruchsberechtigt?
Grundsätzlich steht laut § 114 ZPO jeder am Prozess beteiligten Person ein Anspruch auf Prozesskostenhilfe zu. Demnach kann sowohl der Kläger als auch der Beklagte Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen. Gleiches gilt für einen sogenannten Nebenintervenienten oder für sonstige Prozessbeteiligte.
Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe
Prozesskostenhilfe wird gemäß § 117 ZPO nur auf Antrag hin gewährt. Ein solcher kann entweder schriftlich oder aber mündlich und zu Protokoll bei der Geschäftsstelle des jeweiligen Gerichtes gestellt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, einen entsprechenden Antrag im Rahmen eines Gerichtstermins zu stellen. Der Antrag ist stets an das Gericht zu richten, bei dem das Verfahren anhängig ist beziehungsweise anhängig gemacht werden soll. Eine Klage ist dann anhängig, wenn die Klageschrift bei Gericht eingereicht wurde.
Gut zu wissen: Der Begriff “anhängig” ist abzugrenzen von dem Begriff “rechtshängig”. Rechtshängigkeit bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem die Klageschrift dem Beklagten zugeht.
Ein entsprechender Formzwang besteht hinsichtlich der Antragstellung selbst nicht. Allerdings muss im Rahmen der Darlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse ein entsprechendes amtliches Formular verwendet werden.
Zu welchem Zeitpunkt kann der Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt werden?

Der Antrag kann
- vor der Klageerhebung
- zusammen mit der Klageschrift oder
- jederzeit nach Klageerhebung, jedoch vor Beendigung des Verfahrens
gestellt werden.
Welche Dokumente werden für die Antragstellung benötigt?
Wer Prozesskostenhilfe beantragen möchte, der sollte die folgenden Dokumente vorlegen können:
- Personalausweis oder Reisepass
- Einkommensnachweise
- Nachweise über monatliche Zahlungsverpflichtungen
- Kontoauszüge der letzten drei Monate
- Unterlagen betreffend die zugrunde liegende Klageschrift
Wer bekommt Gerichtskostenbeihilfe?
Um in den Genuss einer Prozesskostenhilfe zu kommen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.
- Der Antragsteller muss wirtschaftlich bedürftig im Sinne der ZPO sein
- Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe muss hinreichende Aussicht auf Erfolg haben
- Die Rechtsverfolgung darf nicht mutwillig erscheinen
Prozesskostenhilfe trotz Rechtschutzversicherung?
Sofern der Antragsteller rechtsschutzversichert ist, hindert dies die Beantragung und die Bewilligung von Prozesskostenhilfe zunächst nicht. Sofern allerdings von Seiten der Versicherung eine Deckungszusage erfolgt, entfällt zumindest die Voraussetzung der wirtschaftlichen Bedürftigkeit des Antragstellers. Aus § 120 a Absatz 2 ZPO begründet sich in diesem Fall eine Mitteilungspflicht gegenüber dem Gericht.
Zwischenzeitliche Verbesserung der finanziellen Situation
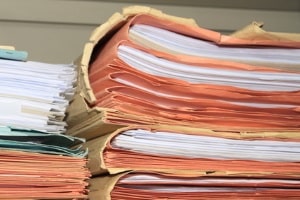
Sofern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren seit der Beendigung des Verfahrens (aufgrund gerichtlicher Entscheidung oder aus sonstigen Gründen) wesentlich verbessern, so muss der Betroffene dies dem Gericht unverzüglich mitteilen. Dies ergibt sich ebenfalls aus § 120 a Absatz 2 ZPO.
Sofern der Antragsteller ein monatliches Einkommen bezieht, ist eine Verbesserung des Einkommens dann wesentlich, wenn die Differenz zum vorherigen Einkommen nicht nur einmalig einen Betrag von 100,- EUR übersteigt.
Eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse kann insbesondere dann eintreten, wenn die antragstellende Partei durch die Rechtsverfolgung etwas erlangt hat.
Zur Erklärung einer wesentlichen Verbesserung der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse muss der Betroffene ein bestimmtes der Vorschrift des § 117 Absatz 3 ZPO entsprechendes Formular benutzen.
Die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen
Ob der Antragsteller wirtschaftlich bedürftig im Sinne der ZPO ist, ist anhand der „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse“ darzulegen und zu ermitteln.
Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) oder SGB XII sind im Rahmen der Berechnungsmodalitäten stets ein Indiz für die Bedürftigkeit. Doch auch ohne den Bezug derartiger Sozialleistungen kann eine solche angenommen werden.
Wie ermittelt man die Einkommensgrenze?
Beim „Armenrecht“ wird die Einkommensgrenze in drei Schritten ermittelt. Dabei wird berechnet, welchen Betrag der Antragsteller grundsätzlich in den Prozess investieren könnte. Die Berechnung vollzieht sich in vier Schritten:
- Schritt 1: Ermittlung der monatlichen Einkünfte (= Einkommen)
- Schritt 2: Abzug der laufenden Ausgaben/Kosten
- Schritt 3: Anrechnung von Freibeträgen
- Schritt 4: Ermittlung von verwertbarem Vermögen
Schritt 1: Die Ermittlung der monatlichen Einkünfte (= Einkommen)
Im ersten Schritt wird ermittelt, wie hoch die monatlichen Einkünfte des Antragstellers sind. Hier sind die folgenden Positionen zu berücksichtigen:
- Einnahmen aus Vermietung/ Verpachtungen von Wohnungen oder Grundstücken
- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkei
- Arbeitslohn
- Kindergeld
- Wohngeld
- Sozialleistungen
- Rente/ Pension
- Unterhaltszahlungen
Schritt 2: Abzug der laufenden Ausgaben/Kosten

Von den regelmäßigen Einnahmen sind sodann die laufenden Kosten abzuziehen. Hierzu zählen:
- Miete
- Nebenkosten
- Kosten für die Fahrt zur Arbeit
- Kosten für Versicherungen (zum Beispiel: Hausrat, Haftpflicht, Lebensversicherung)
Luxusgüter werden nicht in die laufenden Kosten mit einbezogen. Als solche kommen beispielsweise laufende Kosten für die Unterhaltung einer Luxusyacht in Betracht.
Schritt 3:
Bei der Frage nach der Gewährung von Prozesskostenhilfe werden sogenannte Freibeträge berücksichtigt. Diese sollen sicherstellen, dass der Antragsteller nicht das gesamte, ihm noch verbleibende Vermögen, welches er monatlich nach dem Abzug der laufenden Kosten zur Verfügung hat, in den Prozess investieren muss. Es lassen sich die folgenden Freibeträge anführen:
- Für sich selbst kann der Antragsteller einen Betrag von 462,- EUR anrechnen
- Berufstätige können weitere 215,- EUR anrechnen
- Erwachsene, die Unterhalt bekommen, werden 370,- EUR angerechnet
- Für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren ist ein Betrag von 349,- EUR anzurechnen
- Für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren sind 349,- EUR anzurechnen
- Für Kinder bis 6 Jahren sind 268,- EUR anzurechnen
Schritt 4: Verwertbares Vermögen
Besitzt der Antragsteller Vermögenswerte, müssen diese im Scheidungsprozess grundsätzlich erst aufgebraucht werden, bevor Prozesskostenhilfe in Anspruch genommen werden kann. Hiervon gibt es allerdings in den folgenden Fällen Ausnahmen.
- Es handelt sich um ein Geldvermögen bis 2000,- EUR
- Der Antragsteller hat eine selbst bewohnte Immobilie
- Es handelt sich um Vermögenswerte zur Altersvorsorge
- Es handelt sich um für die Berufsausübung notwendige Vermögenswerte
Weitere Voraussetzung
Wie oben bereits angeführt, muss die Bewilligung von Prozesskostenhilfe hinreichende Aussicht auf Erfolg haben.
Des Weiteren darf gemäß § 114 Absatz 2 ZPO die Rechtsverfolgung nicht mutwillig erscheinen. Dies wäre dann anzunehmen, wenn eine wirtschaftlich besser aufgestellte Person trotz bestehender Erfolgsaussichten keine Klage erhoben hätte.
Entscheidung über den Antrag auf Prozesskostenhilfe
Das Gericht entscheidet sodann, ob die Verfahrenskostenhilfe bewilligt wird oder eben nicht.
Gewährung von Prozesskostenhilfe

Geht der Antrag durch, wird dem Antragsteller Prozesskostenhilfe gewährt. In diesem Fall ist er von der Zahlung sowohl der Gerichts- als auch der Verfahrenskosten befreit.
Sofern in einem Verfahren die Vertretung durch einen Rechtsanwalt vorgeschrieben ist, wird der Prozesskostenhilfe beantragenden Partei ein zur Vertretung bereiter Anwalt seiner Wahl beigeordnet, also gestellt. Dies ergibt sich aus § 121 Absatz 1 ZPO. Für den Fall, dass in dem zugrunde liegenden Verfahren ein Anwaltszwang hingegen nicht besteht, wird ein Rechtsanwalt dann wiederum nur für den Fall gestellt, dass die anwaltliche Vertretung erforderlich erscheint. Gleiches gilt für denn Fall, dass der jeweilige Prozessgegner anwaltliche vertreten wird. Dies ist in Absatz 2 des § 121 ZPO geregelt.
Grundsätzlich wird ein Anwalt beigeordnet, der in dem Bezirk niedergelassen ist, in dem der Prozess stattfindet. Ein außerhalb dieses Bezirkes ansässiger Anwalt kann nur dann beigeordnet werden, wenn dadurch keine weiteren Kosten entstehen.
Durch die gerichtliche Beiordnung entsteht demjenigen Rechtsanwalt, der zum Prozess beigeordnet wurde, ein Zahlungsanspruch gegen die Staatskasse. Gleichzeitig löst die Beiordnung eine Forderungssperre gegen den Antragsteller selbst aus. Ab dem Zeitpunkt kann er also seinem Mandanten gegenüber nicht mehr abrechnen.
Was passiert, wenn der Prozess verloren wird?

Sofern, trotz Bewilligung einer Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsanwaltes, der Antragsteller prozessual unterliegt, werden zwar unter anderem die Anwaltskosten für seine Verteidigung aus der Staatskasse beglichen, nicht hingegen die Kosten des gegnerischen Anwaltes. Diese muss der Betroffene trotz allem selbst begleichen.
Ablehnung von Prozesskostenhilfe
Sofern der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe abgelehnt wird, kann der Antragsteller mit dem Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde im Sinne des § 567 ZPO dagegen vorgehen. Sofern es in dem Verfahren um einen Betrag geht, der 600,- EUR nicht übersteigt, ist die Zurückweisung eines Antrages auf Prozesskostenhilfe hingegen nicht anfechtbar, sofern das Gericht nicht lediglich die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verneint hat.
Muss die Prozesskostenhilfe zurückgezahlt werden?
Grundsätzlich muss eine einmal gewährte Prozesskostenhilfe nicht abbezahlt werden. Allerdings gibt es Fälle, in denen eine bewilligte Prozesskostenhilfe zu einer Rückzahlung verpflichtet. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn der Antragsteller innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren nach dem Gerichtsverfahren wieder über mehr Geld verfügt. In diesem Fall kann eine ratenweise Rückzahlung der erstatteten Beträge gefordert werden. Eine derartige Rückzahlungsverpflichtung ist dann allerdings der jeweiligen finanziellen Situation anzupassen.
Prozesskostenhilfe für das Verfahren auf Prozesskostenhilfe?
Für das Prozesskostenverfahren selbst wird keine Prozesskostenhilfe gewährt. Der Grund dafür liegt in dem Umstand, dass das Prozesskostenverfahren selbst nicht als gerichtliches Verfahren gilt. Allerdings besteht in diesem Fall die Möglichkeit, eine sogenannte Beratungshilfe in Anspruch zu nehmen. Die hierbei zugrunde liegenden Vorschriften und Regelungen sind im Beratungshilfegesetz (kurz: BerHG) enthalten.
Beratungshilfe wird also im Gegensatz zur Prozesskostenhilfe für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens gewährt. Das Beratungshilfegesetz schließt dadurch Lücken im außergerichtlichen Rechtsschutz.
Risiken im Rahmen des Prozesskostenhilfeverfahrens

Wer ein Gerichtsverfahren anstrebt, der sollte sich möglichst präzise über die Höhe der zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten kundig machen. Prozesskostenhilfe schließt nicht jedes Kostenrisiko aus.
Verlieren Betroffene den Prozess, müssen sie die Kosten für den gegnerischen Anwalt selbst bezahlen. Die Prozesskostenhilfe springt an dieser Stelle nicht ein.
Eine Ausnahme davon besteht allerdings im Rahmen der Arbeitsgerichtsbarkeit. Hier muss der Betroffene im Falle des Unterliegens zumindest in der ersten Instanz nicht die Anwaltskosten der gegnerischen Partei erstatten.
Fazit

Prozesskostenhilfe eröffnet wirtschaftlich schlechter aufgestellten Personen die Möglichkeit, ihre rechtlichen Interessen auch auf dem Gerichtswege durchzusetzen.
Somit wird die Inanspruchnahme der Gerichte grundsätzlich jedermann gewährt. Soziale Ungleichheiten werden dadurch angepasst.
Dennoch sollten Betroffene stets im Hinterkopf behalten, dass die Gewährung von Prozesskostenhilfe eben nicht zwangsläufig Schutz vor sämtlichen in Betracht kommenden Kosten bietet.
Konnten wir Ihnen weiterhelfen? Dann bewerten Sie uns bitte:
Mein Antrag auf Gerichtskostenbeihilfe beläuft ich auf den Wiederspruch beim Jobcenter für ein darhlen um meine Mietschulden zu begleichen da ich sie selbst nicht begleichen kann und mir sonst der Wohnungsverlust droht denke ich es ist besser wenn mich ein Rechtspfleger bei diesem Wiederspruch begleitet